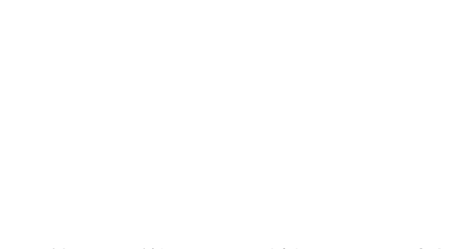Schenkung Immobilien: Alle Infos, Kosten, Steuern & Co.
Finden Sie heraus, was Ihre Immobilie wert ist:
Erstellt am:
Zuletzt bearbeitet:
Eine Immobilie zu verschenken klingt nach einer einfachen Geste – ist aber rechtlich, steuerlich und finanziell oft komplexer als gedacht. Wer früh plant, kann Steuern sparen, Streit vermeiden und seine Immobilie gezielt weitergeben. In diesem Artikel erfahren Sie, wie eine Immobilienschenkung funktioniert, was sie kostet, wann sie sinnvoll ist und worauf Sie unbedingt achten sollten.
Inhalt:
- Das Wichtigste in Kürze
- Was bedeutet die Schenkung einer Immobilie?
- Immobilie verschenken: Was bei Kindern, Ehepartnern oder Dritten zu beachten ist
- Ablauf der Schenkung einer Immobilie
- Welche Kosten entstehen bei der Schenkung einer Immobilie?
- Steuern bei der der Immobilienschenkung
- Die 10-Jahresfrist bei der Schenkung von Immobilien
- Rückübertragung: Kann die Schenkung der Immobilie rückgängig gemacht werden?
- Schenkung oder Vererbung: Was ist sinnvoller?
- Häufige Fragen
1. Das Wichtigste in Kürze
-
Formvorgabe: Eine Immobilienschenkung ist nur mit notariellem Vertrag gültig und muss ins Grundbuch eingetragen werden.
-
Steuerfreiheit: Innerhalb der Familie gelten hohe Freibeträge, etwa 400.000 Euro für Kinder oder 500.000 Euro für Ehepartner. Nur der Anteil über diesen Grenzen muss versteuert werden.
-
Steuerplanung: Frühzeitige Schenkungen ermöglichen die mehrfache Nutzung von Freibeträgen alle 10 Jahre.
-
Absicherung: Mit Nießbrauch oder Wohnrecht kann der Schenker die Immobilie weiter nutzen und reduziert gleichzeitig den Wert, den das Finanzamt besteuert.
-
Rückforderung: Eine Rückforderung der Immobilie nach Schenkung ist nur bei grobem Undank, Notlage oder vertraglicher Vereinbarung möglich.
2. Was bedeutet die Schenkung einer Immobilie?
Bei einer Immobilienschenkung geht das Eigentum an einem Haus, einer Wohnung oder einem Grundstück ohne Gegenleistung auf eine andere Person über. In der Regel findet das innerhalb der Familie statt, zum Beispiel zwischen Eltern und Kindern. Auch wenn kein Geld fließt, ist der Vorgang rechtlich anspruchsvoll und ist rechtlich nur mit Notar und Grundbucheintrag gültig (Details dazu gleich noch im Ablaufteil). Im Unterschied zur Vererbung erfolgt die Schenkung bereits zu Lebzeiten. Das ermöglicht es, frühzeitig selbst zu entscheiden, wer die Immobilie erhalten soll. Zudem können steuerliche Freibeträge besser genutzt werden, da sie in regelmäßigen Abständen von zehn Jahren erneut genutzt werden können.. Wer diesen Schritt bewusst plant, kann spätere Erbstreitigkeiten vermeiden und individuelle Vorstellungen gezielt umsetzen.

Sind möchten wissen, was Ihre Immobilie wert ist?
So schaffen Sie Klarheit: Starten Sie doch mit einer kostenlosen Immobilienbewertung.
Immobilienbewertung starten3. Immobilie verschenken: Was bei Kindern, Ehepartnern oder Dritten zu beachten ist
Je nach Beziehung zwischen Schenker und Empfänger gelten unterschiedliche Freibeträge, Formvorgaben und Fallstricke:
Schenkung einer selbstgenutzten Immobilie an Kind(er)
Eltern können ihren Kindern alle 10 Jahre einen Freibetrag von derzeit 400.000 Euro gewähren. Dieser Betrag kann alle zehn Jahre steuerfrei genutzt werden. Wird eine selbstgenutzte Immobilie verschenkt und das Kind zieht selbst ein, kann die Schenkung unter Umständen sogar ganz steuerfrei sein. Wichtig ist dabei, dass das Kind das Objekt über mindestens 10 Jahre selbst nutzt. Wird diese Bedingung nicht erfüllt, kann das Finanzamt die Steuerbefreiung rückwirkend streichen.
Schenkung der Immobilie unter Ehepartnern (Zugewinngemeinschaft)
Auch unter Eheleuten ist die Schenkung einer Immobilie möglich (Freibetrag von 500.000 Euro). Häufig nutzen Paare diese Möglichkeit zur Vermögensverlagerung oder zur gemeinsamen Vorsorge. Bei einer Zugewinngemeinschaft ist keine Gütertrennung erforderlich: Die Übertragung erfolgt im Rahmen eines notariellen Vertrags. Steuerlich kann sich die Schenkung lohnen, insbesondere bei größerem Immobilienvermögen. Hinweis: Die Zugewinngemeinschaft ist übrigens der gesetzliche Güterstand bei Ehen in Deutschland. Sie bedeutet, dass während der Ehe das Vermögen getrennt bleibt, aber im Falle einer Scheidung oder im Erbfall ein finanzieller Ausgleich des Zugewinns stattfindet.
Immobilienschenkung mit Nießbrauch
Wer seine Immobilie verschenkt, aber weiterhin darin wohnen oder Mieteinnahmen erhalten möchte, kann sich ein sogenanntes Nießbrauchrecht sichern. Dieses Recht wird notariell vereinbart und im Grundbuch eingetragen. Der Nießbrauch reduziert auch den steuerlichen Immobilienwert (mehr dazu im Steuerteil).
Schenkung an Dritte außerhalb der Familie
Auch an Freunde, Lebensgefährten oder andere Personen kann eine Immobilie verschenkt werden. Allerdings fällt hier der Freibetrag deutlich geringer aus. Aktuell liegt er bei nur 20.000 Euro. Alles darüber hinaus wird besteuert, oft mit höheren Steuersätzen. Wer diesen Schritt plant, sollte rechtzeitig steuerliche Beratung in Anspruch nehmen und mögliche Alternativen wie Teilübertragungen oder Testamentslösungen prüfen.
Schenkung an mehrere Personen gleichzeitig
Wird eine Immobilie an mehrere Personen verschenkt, zum Beispiel an zwei Kinder oder an ein Kind und dessen Partner, muss der Vorgang sorgfältig vorbereitet werden. Jede Person erhält einen Anteil – was sowohl den Grundbuch-Eintrag als auch die steuerliche Bewertung betrifft. Jeder Beschenkte hat einen eigenen Freibetrag, was vorteilhaft sein kann. Gleichzeitig sollte geklärt werden, wie mit der Immobilie künftig umgegangen wird, etwa bei Verkauf, Nutzung oder Renovierung. Je mehr Beteiligte, desto wichtiger ist eine klare vertragliche Regelung.
4. Ablauf der Schenkung einer Immobilie
Die Schenkung einer Immobilie ist kein formloser Akt. Auch wenn kein Geld fließt, wird sie rechtlich wie ein Verkauf behandelt. Heißt: Mit Notar, Grundbucheintrag und steuerlicher Prüfung.
So läuft die Schenkung ab:
1. Einigung zwischen Schenker und Beschenktem: Beide Parteien müssen sich einig sein, dass die Immobilie ohne Gegenleistung übertragen wird. Diese Vereinbarung ist Grundlage für den weiteren Ablauf.
2. Notarieller Schenkungsvertrag: Der Notar erstellt den Vertrag, klärt rechtliche Details und berät zu Sonderregelungen wie Nießbrauch oder Rückforderungen. Erst mit der notariellen Beurkundung ist die Schenkung rechtsgültig.
3. Eintragung ins Grundbuch: Der Notar leitet den Vertrag an das Grundbuchamt weiter. Nach Prüfung wird der neue Eigentümer eingetragen. Erst dann ist die Übertragung offiziell abgeschlossen.
4. Meldung an das Finanzamt: Gleichzeitig wird das Finanzamt automatisch informiert. Es bewertet die Immobilie und prüft, ob Schenkungsteuer anfällt. Für die Wertermittlung werden meist Bodenrichtwerte oder Vergleichswerte genutzt. In Einzelfällen kann ein Gutachten sinnvoll sein.
5. Eintrag besonderer Rechte (optional): Wird z. B. ein Nießbrauchrecht, Wohnrecht oder eine Rückforderungsklausel vereinbart, werden diese im Vertrag festgehalten und ebenfalls im Grundbuch vermerkt.
Hinweis: Auch nach der Übertragung kann die Schenkung noch Auswirkungen haben. Das betrifft zum Beispiel die 10-Jahresfrist für die Schenkungsteuer, mögliche Pflichtteilsansprüche oder vertraglich vereinbarte Rückforderungsrechte. Wer diese Punkte von Anfang an berücksichtigt, kann spätere Konflikte und Kosten vermeiden.

Suchagent aktivieren und passende Angebote erhalten
Noch auf der Suche nach der richtigen Immobilie? Hinterlegen Sie Ihre Suchkriterien und wir senden Ihnen passende Objekte.
Jetzt Suchagent aktivieren5. Welche Kosten entstehen bei der Schenkung einer Immobilie?
Je nach Gestaltung können mehrere Gebühren und Abgaben anfallen, die bei der Planung berücksichtigt werden sollten. Einige davon sind verpflichtend, andere abhängig von individuellen Vereinbarungen:
1. Notarkosten Ein Notar ist gesetzlich vorgeschrieben. Er erstellt den Schenkungsvertrag, begleitet die Beurkundung und leitet alles ans Grundbuchamt weiter. Die Gebühren richten sich nach dem Wert der Immobilie und bewegen sich meist zwischen 1 und 2 % des Immobilienwerts.
2. Grundbuchkosten Die Umschreibung im Grundbuch löst weitere Gebühren aus. Auch hier richtet sich die Höhe nach dem Immobilienwert. Typischerweise liegen die Grundbuchkosten zwischen 0,3 und 0,5 % des Werts.
3. Kosten für Gutachten oder Wertermittlung (optional) Das Finanzamt braucht einen Immobilienwert zur Berechnung der Schenkungsteuer. Wird kein offizieller Kaufpreis angesetzt, kann ein Gutachten sinnvoll sein – etwa bei Unsicherheiten über Bodenrichtwert oder Marktwert. Die Kosten variieren stark, je nach Umfang und Anbieter.
4. Steuerliche Kosten (je nach Verwandtschaftsgrad) Ob und wie viel Schenkungsteuer anfällt, hängt vom Verhältnis zwischen Schenker und Beschenkten sowie vom Wert der Immobilie ab.
Beispiele (wie vorab bereits erwähnt):
-
Kinder haben aktuell einen Freibetrag von 400.000 Euro
-
Ehepartner sogar 500.000 Euro. Liegt der Immobilienwert darüber, wird der Überschuss versteuert. Die Steuersätze reichen von 7 % bis 50 %, je nach Verwandtschaft und Höhe des Betrags.
5. Kosten für Nießbrauch, Wohnrecht oder Rückforderungsvereinbarungen (optional) Wird zusätzlich ein Nießbrauch oder Wohnrecht vereinbart, entstehen weitere Notar- und Grundbuchkosten. Diese Rechte mindern aber auch den steuerlich relevanten Wert (was sich positiv auf die Schenkungsteuer auswirken kann).
6. Grunderwerbsteuer Bei einer reinen Schenkung fällt keine Grunderwerbsteuer an (§ 3 GrEStG). Nur wenn eine Gegenleistung vereinbart wird (z. B. bei Nießbrauch mit Ablöse oder Schuldübernahme) kann sie in Einzelfällen fällig werden.
6. Steuern bei der der Immobilienschenkung
Ob eine Schenkung steuerlich etwas kostet, hängt vor allem vom Verwandtschaftsverhältnis und vom Wert der Immobilie ab. Der Staat gewährt Freibeträge – alles, was darüber liegt, muss versteuert werden. Wer gut plant, kann mit einer Schenkung sogar Steuern sparen.
Freibeträge: So viel bleibt steuerfrei Je näher der Beschenkte mit dem Schenkenden verwandt ist, desto höher fällt der persönliche Freibetrag aus. Diese gelten jeweils pro Schenkung und können alle zehn Jahre erneut genutzt werden:
- Ehepartner: 500.000 Euro
- Kinder: 400.000 Euro
- Enkel (wenn die Eltern bereits verstorben sind): 400.000 Euro
- Enkel (wenn die Eltern noch leben): 200.000 Euro
- Eltern, Geschwister, Schwiegerkinder, Freunde etc.: 20.000 Euro
Steuersätze: Was darüber hinaus fällig wird
Wird der Freibetrag überschritten, greift die Schenkungsteuer. Die Höhe richtet sich nach der Steuerklasse und dem Betrag, der über dem Freibetrag liegt:
| Steuerklasse | Verwandtschaft | Steuersatz |
|---|---|---|
| 1 | Ehepartner, Kinder, Enkel | 7% - 30 % |
| 2 | Geschwister, Neffen/Nichten | 15 % - 43 % |
| 3 | Freunde, nicht Verwandte | 30 % - 50 % |
Wichtig: Der Steuersatz steigt mit dem Wert der Schenkung. Bei hohen Werten und schwachem Verwandtschaftsgrad kann die Steuerbelastung deutlich ausfallen.
Sonderfall: Nießbrauch mindert den Steuerwert. Wird bei der Schenkung ein Nießbrauchrecht oder Wohnrecht für den Schenker vereinbart, mindert das den steuerlich relevanten Immobilienwert. Das kann helfen, unter dem Freibetrag zu bleiben oder zumindest den zu versteuernden Anteil zu reduzieren.
Beispiel zur Verdeutlichung: Wird ein Nießbrauchrecht im Wert von 300.000 Euro eingetragen, reduziert sich der steuerpflichtige Immobilienwert um genau diesen Betrag. So kann eine Immobilie unter den Freibetrag fallen oder zumindest die Steuerlast deutlich sinken.

Jetzt Traum-Immobile finden
Entdecken Sie unser umfangreiches Immobilienangebot - Vom Eigenheim, über Gewerbe bis hin zur lukrativen Kapitalanlage.
Jetzt entdecken7. Die 10-Jahresfrist bei der Schenkung von Immobilien
Die 10-Jahresfrist ist bei Immobilienschenkungen aus zwei Gründen wichtig:
- Für die Schenkungsteuer
- und für mögliche Pflichtteilsansprüche.
Freibeträge mehrfach nutzen: Schenkende können persönliche Freibeträge alle zehn Jahre erneut ausschöpfen. Wer frühzeitig schenkt, kann große Vermögenswerte gestaffelt und steuerfrei übertragen.
Pflichtteilsergänzung vermeiden: Stirbt der Schenker innerhalb von zehn Jahren, können enterbte Angehörige noch Ansprüche geltend machen. Mit jedem Jahr reduziert sich der anrechenbare Anteil. Nach zehn Jahren entfällt der Anspruch vollständig.
- Zusatz: Enterbte Kinder können trotz Schenkung Ansprüche geltend machen, den sogenannten Pflichtteilsergänzungsanspruch. Dieser wird jährlich um 10 % reduziert und entfällt nach zehn Jahren vollständig (§ 2325 BGB).
Fristbeginn beachten: Die Frist läuft ab dem Zeitpunkt der Eigentumsumschreibung im Grundbuch. Wird ein Nießbrauch oder Wohnrecht vereinbart, beginnt sie erst nach dessen Ende.
8. Rückübertragung: Kann die Schenkung der Immobilie rückgängig gemacht werden?
Eine Schenkung ist grundsätzlich bindend. Wer eine Immobilie verschenkt, verliert das Eigentum dauerhaft. Dennoch gibt es Ausnahmen, unter denen eine Rückforderung möglich ist.
1. Rückforderung aus Notlage Wenn sich die finanzielle oder persönliche Situation des Schenkenden stark verschlechtert, kann in bestimmten Fällen eine Rückübertragung verlangt werden. Voraussetzung ist, dass der Schenker ohne die Immobilie nicht mehr ausreichend versorgt wäre.
2. Rückforderung wegen groben Undanks Wird der Schenker vom Beschenkten schwer beleidigt, bedroht oder misshandelt, kann das als grober Undank gelten. In solchen Fällen ist eine Rückabwicklung juristisch denkbar, aber meist schwer durchzusetzen.
3. Vertraglich vereinbarte Rückforderungsrechte Sichere Rücktrittsmöglichkeiten lassen sich bereits im Schenkungsvertrag festhalten. Häufig genannte Gründe sind etwa Trennung, Insolvenz oder ein vorzeitiger Verkauf der Immobilie. Solche Klauseln sollten immer notariell geregelt und im Grundbuch gesichert werden.
Fazit: Ein Rücktritt von der Schenkung ist nur unter engen Voraussetzungen möglich. Wer Spielraum behalten möchte, sollte Rückforderungsrechte gleich zu Beginn schriftlich festlegen.
9. Schenkung oder Vererbung: Was ist sinnvoller?
Ob eine Immobilie verschenkt oder vererbt werden soll, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören unter anderem Alter, Vermögensverhältnisse, familiäre Situation und steuerliche Ziele. Beide Wege sind rechtlich möglich, unterscheiden sich aber deutlich in ihren Auswirkungen.
Vorteile der lebzeitigen Übertragung
Eine Schenkung zu Lebzeiten bietet klare Gestaltungsmöglichkeiten. Der Eigentümer kann genau festlegen, wer die Immobilie bekommt und unter welchen Bedingungen. Steuerfreibeträge lassen sich besser ausschöpfen, da sie alle zehn Jahre erneut genutzt werden können. Außerdem können Rechte wie Nießbrauch oder Wohnrecht vereinbart werden, um die eigene Absicherung zu gewährleisten. Wer frühzeitig handelt, kann auch spätere Erbstreitigkeiten vermeiden.
Wann lohnt sich welche Option
Eine Schenkung lohnt sich vor allem dann, wenn die Immobilie langfristig in der Familie bleiben soll und steuerliche Vorteile genutzt werden sollen. Auch bei komplexen Familienverhältnissen oder Wunsch nach Kontrolle bietet sie Vorteile. Eine Vererbung ist sinnvoll, wenn der Eigentümer bis zum Lebensende frei über die Immobilie verfügen möchte oder wenn die Übertragung erst im Todesfall erfolgen soll. In manchen Fällen ist eine Kombination beider Wege möglich, zum Beispiel durch eine teilweise Schenkung zu Lebzeiten und eine ergänzende testamentarische Regelung.
10. Häufige Fragen
Weitere Ratgeber zum Thema Immobilienverkauf
Melden Sie sich an und erhalten Sie regelmäßig neue Informationen und aktuelle Immobilienangebote.